Die wenigsten Rezensionen schreibe ich direkt, nachdem ich das Buch ausgelesen und zugeklappt habe. Und bisher habe ich keine einzige Rezension geschrieben, während mir die Tränen noch die Wangen runterlaufen. Es gibt wohl für alles ein erstes Mal.
Es vergeht kaum eine Woche, in der ich nicht die Bücher von Benedict Wells erwähne. Mal bewusst als Buchtipp, mal unbewusst – dann wird mir ein paar Minuten später klar, dass ich eine Textstelle zitiert habe. Inzwischen gibt es den Running Gag, dass man im Internet seinen Namen nur einmal erwähnen muss und ich auf wundersame Weise auftauche wie eine viel schnellere Bloody Mary, die sogar drei Namensnennungen benötigt.

Keine sachliche Rezension
Kann ich also irgendwie sachlich über sein neues Buch schreiben? Nein. Schon allein deshalb nicht, weil mir das Schreiben als solches mehr bedeutet, als ich bisher öffentlich zugegeben habe. (An dieser Stelle ein Gruß an einen Freund, der – selbst Autor – vor wenigen Tagen diese Info völlig verdattert zur Kenntnis nahm.)
„Die Geschichten in uns“ ist aber kein klassischer Schreibratgeber. Keine Reihenfolge von „wenn Du A formulierst, kannst Du in der kommenden Szene B planen“-Tipps. Keine Abhandlung und Analyse der Literaturgeschichte. Und definitiv kein sich selbst beweihräuchernder „seht mal her, was für ein toller Autor ich bin“-Text.
Im Gegenteil.
Benedict Wells wird von vielen als einer gesehen, der richtig gut schreiben kann. U.a. den Literaturpreis der Europäischen Union bekommt man nicht, wenn man „ganz okay“ ist. Dann gibt man auch keine Seminare über das Schreiben.
In der Kampfkunst heißt es, man bleibt immer ein Schüler, auch wenn man zum Lehrer wird. Benedict Wells zeigt im Buch, dass er genau das ist: Er kann lehren – aber lernt selbst noch immer. In vielen Passagen setzt er sich selbstkritisch sogar mit prämierten Veröffentlichungen auseinander, kritisiert Textstellen, die zu meinen Lieblingssätzen zählen und geht dabei mit einem so großartigen Humor vor, dass ich immer wieder laut aufgelacht habe. (Sorry, liebe Nachbarn!)
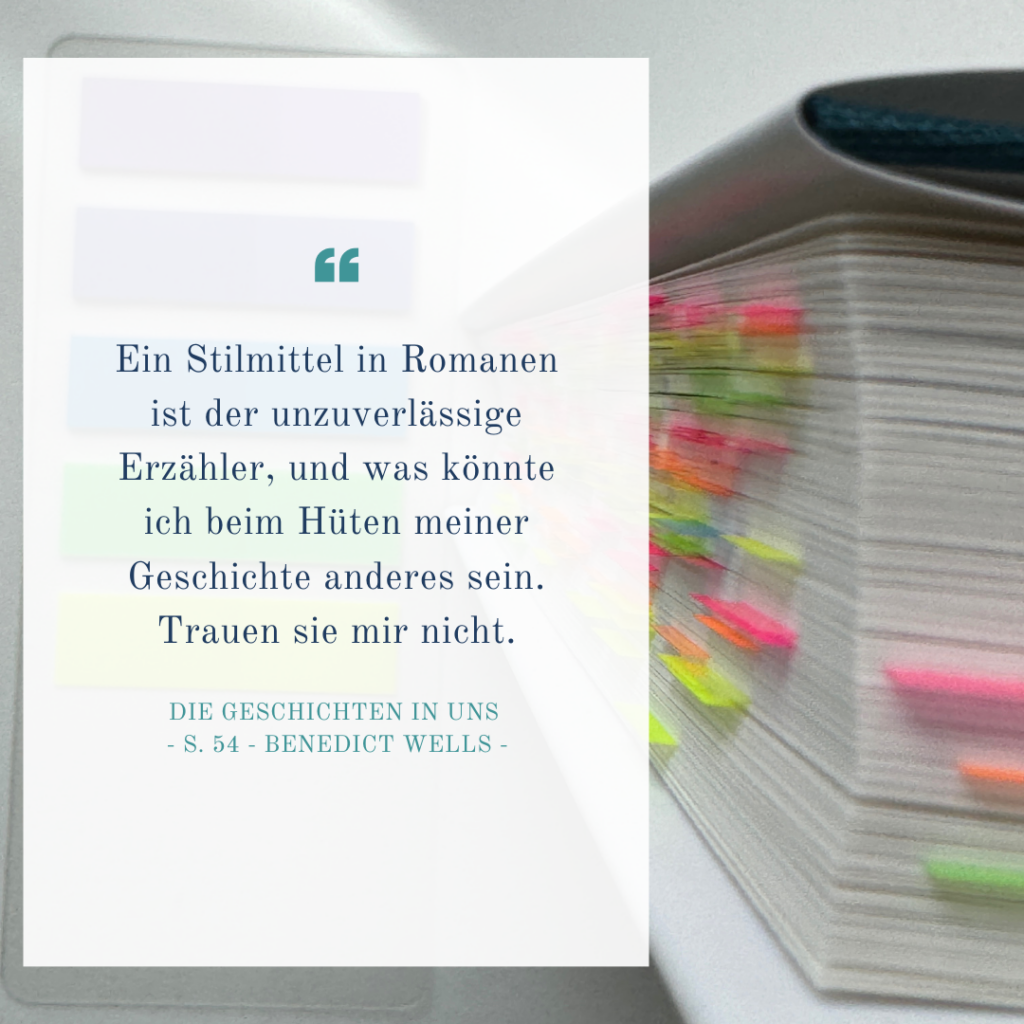
„Die Geschichten in uns“ beginnt aber nicht beim Schreiben – oder, genauer, bei seinem Schreiben. Es beginnt davor. Benedict stellt den Schreibwerkzeugen, die er selbst nutzt, eine autobiografische Skizze voran. Er umreißt seine Herkunft, sein Aufwachsen, seine Familie. In vielen Interviews, die man jetzt mit ihm lesen kann, steht, dass er dabei so persönlich wie nie schreibt. Es mag sein, dass er auf eine Weise offen schildert, was er vorher in seinen Geschichten verarbeitet hat. Er schreibt aber nicht anders.
Wie immer bin ich regelrecht von Seite zu Seite durch den Text gerauscht. Wie immer habe ich im einen Moment gelacht und im nächsten vor Tränen die Worte nicht mehr lesen können. Wie immer wollte ich, dass das Buch nie endet. Und wie immer war sein Text ein erstaunlicher – manchmal ein erschreckender – Spiegel, der mir vorgehalten wurde, obwohl ich das nie vermutet habe. Noch dazu, wo unsere Biografien nicht unterschiedlicher sein könnten.
Für wen ist das Buch?
Eine Freundin fragte mich, ob das Buch sich auch lohne, wenn man kein Interesse an Benedict Wells als Autor / Person habe. Man kann mir kaum eine schwierigere Frage stellen, sind seine Bücher doch mit meinem Leserinnenleben verwoben wie kaum ein anderes Werk. Ich versuche mich dennoch an einer Antwort:
Wer sich für Benedict Wells als Person interessiert, sollte das Buch lesen.
Wer sich für den Werdegang und das Denken eines Autors interessiert, sollte das Buch lesen.
Wer sich für das Schreiben interessiert, sollte das Buch lesen.
Und wer sich für nichts von alledem interessiert, aber eine zutiefst berührende Abhandlung darüber lesen möchte, wie die Literatur ein Menschenleben beeinflusst hat – und wie das manchmal im einzelnen funktioniert, dass sie so eine Wirkung entfalten kann – sollte das Buch lesen.
Danke an den Diogenes Verlag, für das Vertrauen und das Rezensionsexemplar.
Und Benedict, falls Dir dieser Text zugespielt wird: Danke.